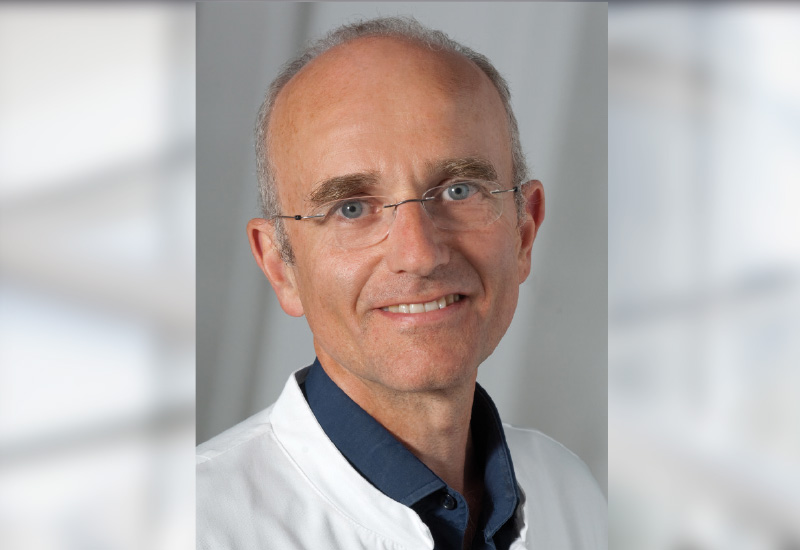Herr Prof. Lorenz, unter Federführung der DGRh wurde nun erstmals eine deutsche S3-Leitlinie zur Diagnose und dem Management des systemischen Lupus erythematodes (SLE) veröffentlicht. Warum ist das so wichtig?
Der große Nutzen einer eigenständigen deutschen Leitlinie besteht darin, dass deren Vorliegen eine Vereinfachung von Verschreibungen im Off-label-Bereich bedeutet. Immer wieder gibt es spezielle Konstellationen, in denen eine Medikation aus ärztlicher Expertise zwar sinnvoll ist, diese in dieser Indikation aber keine Zulassung hat. Vor allem niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen erleichtert es den Umgang mit solchen Situationen, da sie sich jetzt auf diese Empfehlungen berufen können. Hier ist auch unter juristischen Aspekten ein Vorteil gegenüber den EULAR-Empfehlungen zu sehen, weil man sich im Streitfall eindeutig auf dem Boden der deutschen Gesetzgebung bewegt.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die deutsche Leitlinie, die im Wesentlichen auf den EULAR-Empfehlungen aufsetzt, „neuer“ ist. Vor dem Hintergrund der vielen aktuellen Entwicklungen beim SLE konnten durch die 12-15 Monate mehr Zeit für das Literaturreview noch einige Neuerungen berücksichtigt werden.
Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte in der Leitlinie?
Vor allem vier Punkte sind zu nennen. Die erste wichtige Neuerung ist, dass analog zur neuen EULAR-Leitlinie gezielt Glukokortikoide (GK) aufgrund der damit vor allem langfristig assoziierten Organtoxizität eingespart werden sollen, sodass in der Erhaltungstherapie nicht mehr eine Obergrenze von 7,5, sondern jetzt maximal 5 mg/Tag empfohlen wird, verbunden mit der Maßgabe, diese möglichst ganz auszuschleichen.
Der zweite wichtige Punkt betrifft das Antiphospholipidsyndrom (APS), bei dem man sich jetzt ganz klar für Vitamin K-Antagonisten, also hierzulande Marcumar, ausspricht. Direkte orale Antikoagulanzien – zuvor betraf dies nur Rivaroxaban – sollen bei thromboembolischem, insbesondere Hochrisiko-APS und auch bei manifesten arteriellen APS nicht eingesetzt werden. Der dritte Punkt bezieht sich auf das Therapiemanagement in der Schwangerschaft: Jede Schwangere sollte Low-dose-ASS bekommen, bei solchen mit erhöhtem Risiko, sprich mit Antiphospholipidsyndrom oder einem Hochrisiko-Antiphospholipid-Profil, sollte dieses mit niedermolekularem Heparin kombiniert werden.
Viertens werden B-Zell-Agenzien, die bislang auf Rituximab festgelegt waren, jetzt weiter gefasst als B-Zell-gerichtete Therapie. Dies ist angesichts der aktuellen und künftigen Entwicklungen nur folgerichtig, da beispielsweise zu Obinutuzumab bald eine Phase-III-Studie vorliegend wird, zu Dapirolizumab eine solche auf der ACR-Tagung präsentiert wurde und auch Daratumumab bei SLE weiter erprobt wird. Hinzu kommt natürlich der vermehrte Einsatz der CD19 CAR-T-Zelltherapie und – was beim SLE perspektivisch sogar eine noch größere Rolle spielen könnte – der tiefen B-Zell-Depletion mit bispezifischen T-Cell Engager (BiTE)-Antikörpern wie Blinatumomab oder Teclistamab, die ein im Vergleich leichteres Handling ohne präkonditionierende Chemotherapie ermöglichen.
Welche Rolle spielen Biologika in der deutschen Leitlinie?
Ähnlich wie die EULAR sieht auch die deutsche Leitlinie den Einsatz von Biologika, primär Belimumab und Anifrolumab, in bestimmten Situationen auch off-label Rituximab, vor, wenn mit der Standardtherapie keine Remission oder niedrige Krankheitsaktivität erreicht wird oder wenn die Steroiddosis zu hoch ist. In beiden Leitlinien werden in dieser Situation Biologika angesichts fehlender direkter Vergleichsstudien gleichberechtigt mit konventionellen Immunsuppressiva eingestuft, auch wenn die Evidenz für Belimumab oder Anifrolumab aus deren Phase-III-Programmen höher bewertet wird.
Künftig wird deren Stellewert sicherlich noch zunehmen, so wird Anifrolumab – wie zuvor Belimumab – auch bei Lupus Nephritis geprüft. Als neue Anti-B-Zelltherapie wird in dieser Indikation demnächst – positive Phase-III-Daten sind bereits avisiert – vermutlich Obinutuzumab verfügbar werden. Hinzu kommen die bereits genannten, aus der Hämatologie „entlehnten“ BiTE-Antikörper, die bei therapierefraktärem SLE einschließlich Lupus Nephritis äußerst vielversprechend sind.
Im Zusammenhang mit der SLE-Therapie fällt häufig der Ausdruck Treat-to-Target. Was ist damit gemeint? Und wie passt das mit dem übergeordneten Therapieziel der steroidfreien Remission zusammen?
Die Vorteile eines Treat-to-Target-(T2T-)Ansatzes – also die regelmäßige Erfassung der Krankheitsaktivität und entsprechende Anpassung der Therapie bis zum Erreichen des Behandlungsziels – sind von der rheumatoiden Arthritis bekannt und auch beim SLE gut etabliert. So verringert das Erreichen einer möglichst steroidfreien Remission nach den sog. DORIS-Kriterien oder eines Lupus Low Disease Acitivity State (LLDAS) nachweislich das Risiko für Organschäden und Schübe und verbessert somit die Prognose und Lebensqualität der Betroffenen. Noch genauere Erkenntnisse hierzu wird die LUPUS-BEST-Studie liefern, in der prospektiv eine Standardtherapie ohne klar definiertes Ziel und engmaschige Kontrolle über 120 Wochen mit einer T2T-Therapie mit dem Ziel einer weitgehend steroidfreien Remission und/oder LLDAS mit 6-wöchentlichen Kontrollterminen verglichen wird.
Derzeit werden definierte Therapieziele in der täglichen Praxis oft noch verfehlt, wie etwa die deutschen Daten der Beobachtungsstudie SPOCS verdeutlichen, in der weniger als 15 bzw. 30 % der Teilnehmenden eine Remission bzw. einen LLDAS erreichten. Positiv sind die SLE-Daten aus der Kerndokumentation 2022, die auf einen zunehmend geringeren Einsatz von Steroiden vor allem in Dosierungen >5 mg/Tag hinweisen, was dem vermehrten Einsatz von Standardtherapien wie vor allem Hydroxychloroquin und zuletzt auch Biologika geschuldet sein dürfte. Ganz generell ist eine – im Praxisalltag eher selten systematisch durchgeführte – regelmäßige Erfassung der Krankheitsaktivität erforderlich, praktisch gesehen erscheint hier beispielsweise der klinische SLEDAI-Score sinnvoll.
In Ihren aktuellen Empfehlungen für das Management des SLE hat die EULAR die angestrebte Höchstdosis der Glukokortikoide (GK) herabgesetzt, in die deutsche S3-Leitlinie wurde ebenfalls der niedrigere Wert von ≤5 mg/Tag aufgenommen. Warum ist es so wichtig, die GK-Dosis in der SLE-Therapie so gering wie möglich zu halten?
Glukokortikoide sind mit einer Vielzahl kritischer Nebenwirkungen assoziiert, auch und gerade beim SLE ist das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse oder auch Typ-2-Diabetes insbesondere bei einer GK-Dauertherapie beträchtlich. So ist bekannt, dass eine GK-Dosis von >7,5 mg/Tag in der Langzeittherapie das Risiko für neue Organschäden fast verdoppeln kann. Daher sind die aktuellen Empfehlungen der EULAR und DGRh, die GK-Dosis auf <5 mg/Tag zu senken oder am besten komplett auszuschleichen, mehr als nachvollziehbar.
Welche Möglichkeiten gibt es, die GK-Dosierung zu verringern, ohne die Remission zu gefährden?
Zum Erreichen einer steroidfreien Remission, die mitunter, aber eben nicht immer möglich ist, liegen gerade für Biologika wie Belimumab oder zuletzt Anifrolumab recht positive Daten aus Studien bzw. Langzeitbeobachtungen vor. Auch in puncto Steroideinsparung scheinen diese gegenüber konventionellen Immunsuppressiva Vorteile aufzuweisen, es fehlt aber an direkten Vergleichen und natürlich spielen hier auch Kostenaspekte eine Rolle. Zudem ist die individuelle Patientin zu sehen, eine starke Hautbeteiligung wäre etwa ein klares Argument für Anifrolumab, mit dem sich hier exzellente Therapieergebnisse erzielen lassen.
Man sollte überdies stets situationsadaptiert vorgehen: Im Gegensatz etwa zu einer 60-jährigen SLE-Patientin, bei der Steroide möglichst ganz ausgeschlichen werden sollten, gestaltet sich die Situation anders bei einer 25-Jährigen mit Kinderwunsch, wo Biologika ein Problem sein könnten und man gegebenenfalls eher dazu neigt, Low-dose-GK <5 mg/Tag beizubehalten.
Herr Prof. Lorenz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch!