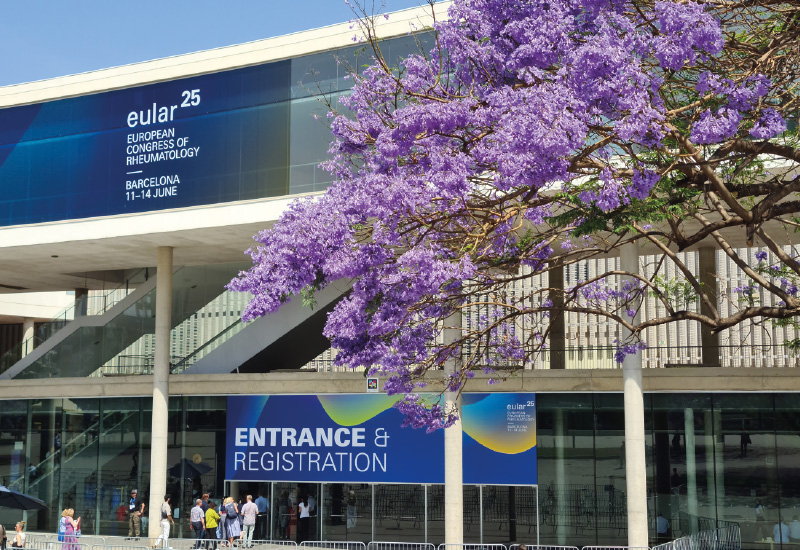Die neuen EULAR-Empfehlungen zur Behandlung der RA
Das Meisterwartete zuletzt: Mit dieser Strategie wartet die EULAR seit Jahren auf, indem sie die Vorstellung aktualisierter Empfehlungen in eine Sitzung am Samstagmittag, also an das Ende des Kongresses legt, so auch in Barcelona: Josef Smolen stellte hier die Aktualisierung der EULAR Recommendations zur Therapie der RA vor. Wer allerdings doch lieber vorher abreiste, hat nicht allzu viel verpasst, denn Neuigkeiten waren in der aktualisierten Fassung nur sehr dosiert zu finden – das Meiste blieb im Vergleich zur vorherigen Ausgabe doch unverändert. Als wesentliche Änderung ist zu erwähnen, dass ein neuerlicher Versuch mit csDMARDs (als Monotherapie oder in Kombination) nicht mehr sinnvoll erscheint, wenn die Starttherapie mit Methotrexat (MTX) + Glukokortikoid (GK) nicht ausreichend wirkt - dies wird per se als ungünstiger Prognosefaktor eingestuft. Zweitlinientherapie ist also bei Versagen der Starttherapie generell ein bDMARD oder ein Januskinase-Inhibitor (JAKi). Alternative csDMARDs wie Leflunomid oder auch eine csDMARD-Kombination kommen – bis auf Ausnahmefälle – nur noch in Frage, wenn MTX kontraindiziert ist oder wegen unerwünschter Effekte abgesetzt werden muss.
Eine weitere, eher kleine Neuerung: Ein Tapering der DMARD-Therapie ist zwar weiterhin Bestandteil der Empfehlungen, von komplettem Absetzen wird jedoch wegen der hohen Wahrscheinlichkeit abgeraten, dass dann meist in kurzer Zeit erneute Flares zu erwarten sind. Bekräftigt wurde, dass eine anhaltende Remission und ein kompletter Stopp der GK-Therapie Voraussetzungen für das DMARD-Tapering sind. Ausdrücklich hervorgehoben wurde von Smolen auch noch einmal, dass aufgrund der Evidenzlage (z. B. NORD-STAR-Studie) nach wie vor der Einsatz von MTX + GK die Starttherapie der ersten Wahl ist – diese bietet gegenüber dem First-Line-Einsatz eines bDMARDs für viele Patienten keine Nachteile.
Allgemeines rund um die RA inklusive Komorbiditäten
Frauen bekommen zwar deutlich häufiger eine RA und sind mehr durch Schmerz und Fatigue geplagt, die schlechtere Prognose haben jedoch Männer. Dies wird u. a. durch eine US-amerikanische Untersuchung von 544.100 hospitalisierten RA-Patienten belegt, darunter 26,2 % Männer. (1)Diese wiesen mit einer Odds Ratio (OR) von 1,27 signifikant mehr pulmonale Komplikationen (inklusive interstitielle Lungenerkrankung, ILD) auf, außerdem mehr Herzinsuffizienz (OR 1,1), Vorhofflimmern (OR 1,40), AV-Block (OR 1,32) und Myokardinfarkt (OR 1,35) sowie eine höhere kardiovaskuläre Mortalität (OR 1,07). Indirekt wird diese Verteilung auch durch Geschlechtsunterschiede im Sicherheitsprofil der JAKi bestätigt (2): Mit einer adjustierten Inzidenz-Rate-Ratio (IRR) von 0,48 traten in einer registerbasierten Studie unter JAKi Malignome bei Frauen signifikant seltener auf, ebenso schwere kardiale (IRR 0,39) und thromboembolische Ereignisse (IRR 0,60). Die Inzidenz thromboembolischer Ereignisse ist bei RA aktivitätsabhängig generell erhöht, dies wurde erneut durch eine Untersuchung der Mayo-Klinik bestätigt. (3) Im Zeitraum 2010 bis 2019 traten tiefe Beinvenenthrombosen im Vergleich zur gematchten Kontrollgruppe mit einer Hazard Ratio (HR) von 1,74, Lungenembolien sogar mit einer HR 2,0 auf. Alter, ein BMI >30, Rauchen, Seropositivität und Komorbiditäten erwiesen sich als signifikante Risikofaktoren, eine Remission im ersten Krankheitsjahr halbierte das Risiko.
Wie häufig ist starker Schmerz bei RA-Patienten trotz kompletter Entzündungskontrolle? Für diese Frage werteten österreichische Kollegen sieben randomisiert-kontrollierte Studien (RCTs) zu bDMARDs mit 2.640 Patienten neu aus. (4) Sie fanden dies bei nur 15 Patienten (<1 %). Baseline-Merkmale der Schmerzpatienten waren u. a. höheres Alter, schlechterer Funktionsstatus, höherer Erosionsscore und – wie zu erwarten – höherer TJC, Schmerz-VAS und Patienteneinschätzung, nicht hingegen CRP, SJC und Arzteinschätzung. Einer interessanten Hypothese zur Risikoerhöhung für RA ging eine französische Gruppe nach: Gibt es perinatale Besonderheiten, die das Risiko erhöhen? Es wurden zwar keine signifikanten Risikofaktoren gefunden, jedoch solche mit Trend: Groß bei der Geburt (HR 1,24), Frühgeburt (HR 1,34), Stillen (HR 1,21) und Tabakexposition im Uterus (HR 1,60). (5)
Ein kleiner Ausflug in die brandaktuelle Literatur wegen der Bedeutung der Ergebnisse: Eine Auswertung aus der schwedischen EIRA-Kohorte mit 1.285 Früharthritis-Patienten unter MTX bestätigte den negativen Einfluss von Adipositas auf den Therapieerfolg: Nach Adjustierung für sämtliche anderen einflussnehmenden Faktoren verblieb eine signifikant reduzierte Aussicht auf das Erreichen einer Remission allein durch den Faktor Adipositas mit einer OR von 1,27. (6)
Die Suche nach Prädiktoren für einen bevorstehenden Flare bei gut eingestellten Patienten war bisher nicht sehr ergiebig. Eine dänische Gruppe wurde jetzt in einer Studie mit 80 RA-Patienten mittels Arthrosonografie fündig. (7) Innerhalb eines Jahres berichteten 36 % einen Flare im Bereich der Hand – als einziger signifikanter Prädiktor erwies sich mit einer OR von 1,28 der sonografische Nachweis einer Tenosynovitis. Im Rahmen des RABBIT-Registers wurde der Frage nachgegangen, wie erfolgreich bDMARDs und tsDMARDs bezüglich der Reduzierung von Fatigue, einem der von Patienten als besonders relevant erachteten Befunde, sind. (8) Alle Biologika und JAKi reduzierten Fatigue erheblich, JAKi wirkten sich im Vergleich zu TNF-Inhibitoren (TNFi) jedoch schneller und nachhaltiger positiv aus.
Glukokortikoide und csDMARDs
Ein systematischer Cochrane-Review untersuchte nochmals die Nutzen-Risiko-Bilanz bei Langzeit-GK-Einnahme. (9) Einerseits ließen sich nur minimale positive Effekte auf niedrige Krankheitsaktivität (LDA), Schmerz und Funktionsstatus belegen, dazu ein moderater Effekt auf die radiologische Progression (praktischer Nutzen bei knapp 20 Punkten im 448 Punkte umfassenden SvdH-Score allerdings sehr fragwürdig). Andererseits zeigten sich jedoch signifikant mehr unerwünschte Ereignisse „of special interest“ mit einem relativem Risiko (RR) von 1,67. Schlussfolgerung: Eine Langzeitgabe ist wegen des mäßigen Nutzens und relativ hohem Schadensrisiko nicht zu empfehlen. Allerdings wies die Berliner Arbeitsgruppe um Frank Buttgereit mit Recht darauf hin, dass etwa zwei Drittel der z. T. hochrangig publizierten Studien, in denen negative Ergebnisse zur Verträglichkeit der GK berichtet wurden, nicht für Krankheits- und Entzündungsaktivität adjustiert waren und somit für eine nicht unerhebliche Verzerrung der Ergebnisse sorgten. (10)
Auf das Risiko der avaskulären Knochennekrose (AKN) bei RA – insbesondere unter GK-Therapie – wies eine türkische Untersuchung hin, unter 2.650 Fällen mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen traten 59 AKN-Fälle (2,2 %) auf, dies mehrheitlich an mehreren Lokalisationen. (11) In 72 % waren die Hüften, 27 % die Knieregion betroffen, bei 70 % in Kombination mit Osteoporose, bei 20 % Osteopenie. Als Risikofaktoren erwiesen sich neben der Osteoporose eine GK-Dosis ≥30 mg/Tag und Anamnese einer Pulstherapie, nicht aber die kumulative GK-Dosis. Clofutriben, ein 11b-Hydroxysteroid-Dehydrogenase-1 (HSD-1)-Inhibitor, der u. a. den intrazellulären Kortisol-Spiegel senkt, könnte die Risiken der GK-Therapie senken, wie eine placebokontrollierte Studie vermuten lässt, die bei 96 Patienten mit Polymyalgia rheumatica durchgeführt wurde. (12) Es gelang eine signifikante Reduktion der unerwünschten Ereignisse sowie positive Beeinflussung der ossären Biomarker, ohne dass die Wirksamkeit verringert wurde.
Den negativen Effekt einer dauerhaften Einnahme von Protonenpumpen-Inhibitoren (PPI; 45 % regelmäßig, 51 % bedarfsweise) auf Knochendichte und Mikroarchitektur des Knochens konnte ebenfalls die Berliner Arbeitsgruppe in einer Kohortenstudie mit 1.909 Patienten zeigen. (13) Es fand sich eine signifikant reduzierte Knochendichte nur an der Wirbelsäule, eine signifikante Beeinträchtigung der Mikroarchitektur des Knochens hingegen sowohl an der Wirbelsäule als auch am Femur. Diese Effekte wurden durch eine Low-dose-GK-Einnahme noch verstärkt. Die PPI-Einnahme war außerdem verbunden mit niedrigeren Cacium- und erhöhten PTH-Spiegeln.
Erneut wurde in einer kanadischen Kohortenstudie bestätigt, dass MTX in der „Rheumadosierung“ nicht mit einem erhöhten Risiko für Leberfibrose verbunden ist (14), es fand sich weder ein Bezug zur generellen Einnahme noch zur Kumulativdosis. Relevante begünstigende Faktoren waren hingegen Alkoholkonsum, Typ-2-Diabetes mellitus und Hypertonie. In einer Untersuchung aus dem DANBIO-Register wurde gezeigt, dass es unter MTX bei eingeschränkter Nierenfunktion zu einem erhöhten Risiko für Anämie und Thrombopenie (aber nicht Neutropenie) kommt. (15) Dies gilt insbesondere für eine GFR <60, was die Notwendigkeit unterstreicht, in diesem Bereich die MTX-Dosis zu verringern.
Malignome und DMARD-Therapie
In einer bevölkerungsbasierten Studie aus dem NOR-DMARD-Register bestätigte sich erneut das signifikant erhöhte Malignom-Risiko für RA-Patienten mit einer IRR von 1,12, für die Mortalität durch Karzinome betrug die IRR 1,16. (16) Die höchste Rate zeigte sich für Lymphome (IRR 2,80), aber auch Bronchialkarzinome boten eine fast verdoppelte Rate. Interessanterweise zeigte sich demgegenüber die Rate bei Patienten mit Psoriasis-Arthritis und axialer Spondyloarthritis nicht erhöht. Eine Auswertung aus dem RABBIT-Register beschäftigte sich mit dem Auftreten von Rezidiven oder Zweitmalignomen bei Patienten mit Malignom-Anamnese unter DMARD-Therapie. (17) Im Zeitraum Ende 2006 bis Ende 2021 traten nur 127 solcher Malignome auf, erfreulicherweise fand sich unter allen Substanzen, also csDMARDs, bDMARDs und JAKi keine unterschiedliche Häufigkeit. In zwei weiteren Registern – der JAK-POT-Studie mit Auswertung von 13 RA-Registern (18) sowie dem spanischen BIOBADASER-Register (19) zeigte sich für das Auftreten neuer Malignome wie schon in einigen Voruntersuchungen eine reduzierte Rate unter TNFi, aber kein Unterschied zwischen non-TNF-bDMARDs, JAKi und csDMARDs. Unter Berücksichtigung der bisher vorliegenden Daten ist wohl am ehesten davon auszugehen, dass TNF-Inhibitoren bezüglich des Malignom-Risikos protektiv wirken.
Während bei den bisher referierten Malignom-Beiträgen Hautkarzinome ausgeschlossen waren, widmete sich eine Kohortenstudie aus dem schwedischen SRQ-Register speziell diesen Malignomen. (20) Es zeigte sich hierbei ein signifikant erhöhtes Risiko für weißen Hautkrebs unter JAKi, während das Risiko für Epithelkarzinome nicht signifikant erhöht war. Generell ist hieraus zu schließen, dass ein regelmäßiges Hautscreening nicht nur wie vorab bekannt unter MTX und Abatacept, sondern auch unter JAKi notwendig ist. Dies bestätigte sich im Übrigen auch in einer globalen Sicherheitsanalyse für Upadacitinib: Eine Auswertung aus elf Phase-III-Studien (4.998 Patienten, 16.683 Patientenjahre) bot insgesamt keine neuen Signale (21), erhöht war im Vergleich zu Kontrollgruppen wie vorbekannt das Herpes Zoster-Risiko, aber auch das Risiko für Non-Melanom-Hautkarzinome (NMSC).
JAK-Inhibitoren und bDMARDs
Es verdichten sich die Hinweise darauf, dass JAK-Inhibitoren bei der RA-assoziierten ILD zu den effektivsten Therapien zählen: In einem systematischen Review mit Auswertung von 20 Publikationen zeigte sich in den meisten Fällen zumindest eine Verhinderung der Progression dieser nach wie vor mit schlechter Prognose verbundenen Manifestation. (22) In einer japanischen Beobachtungsstudie mit 64 RA-ILD-Patienten ergab die Auswertung eine vergleichbare Wirksamkeit von JAKi und Abatacept. (23)
Glucagon-like Peptide-1 (GLP-1)-Agonisten reduzieren offenbar das kardiovaskuläre Risiko unter JAKi-Therapie. In einer Kohortenstudie mit 2.449 RA-Patienten wurde bei gleichzeitiger Einnahme das kardiovaskuläre Gesamtrisiko sowie das Risiko für Koronarsyndrom und thromboembolische Ereignisse um rund ein Drittel verringert. (24) In einer Zwischenanalyse aus der nicht-interventionellen FILOSOPHY-Studie mit Filgotinib wurden 2-Jahres-Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit präsentiert. (25, 26) Drei Ergebnisse zur Wirksamkeit sind herauszuheben: bDMARD-naive Patienten boten über zwei Jahre höhere Response-Raten als Patienten mit bDMARD-Vortherapien, zwischen der Monotherapie und Kombination mit MTX gab es keine Unterschiede und die Persistenz in Monat 6 war mit rund 85 % sehr hoch. Die Sicherheitsanalyse ergab keine neuen Signale, bemerkenswert erscheint, dass zwischen der 200 mg- und 100 mg-Dosis keine Unterschiede zu beobachten waren.
In einer belgischen Real-World-Studie mit 2.389 RA-Patienten, die eine JAKi-Therapie beendet hatten, wurde der Frage nachgegangen, welche Folgetherapie die optimale ist. (27) Als gleichwertig erwiesen sich der Wechsel auf einen zweiten JAKi, auf TNFi und auf einen Interleukin-6-Rezeptorinhibitor (IL-6Ri). Hingegen waren die Erfolgsaussichten bei einem Wechsel auf Abatacept signifikant geringer.
Der Frage, wie häufig es unter TNFi-Therapie tatsächlich zum Auftreten demyelinisierender Erkrankungen kommt, wurde in einer Metanalyse mit Auswertung von neun Studien und mehr als 5.000 Patienten nachgegangen. (28) Die OR lag mit 0,55, also fast einer Verdopplung des Risikos, im signifikanten Bereich. Allerdings zeigte sich zwischen den Studien eine große Heterogenität, drei der Studien boten keine Risikoerhöhung. Nach wie vor ist der Einsatz von TNFi bei Patienten mit demyelinisierenden Erkrankungen nicht kontraindiziert, sollte aber mit Vorsicht erfolgen. Unverändert wird geraten, TNFi im dritten Trimenon der Schwangerschaft möglichst nicht einzusetzen – die Gründe für diese Empfehlung sind allerdings umstritten. Ein beruhigendes Ergebnis lieferte eine kanadische Studie, die der Frage nachging, ob Neugeborene ein erhöhtes Infektionsrisiko aufweisen, wenn die Mutter im dritten Trimenon mit TNFi behandelt wurde. (29) Erfreulicherweise war das nicht der Fall, nur in drei von 75 Fällen kam es zu einer Atemwegsinfektion – eine Rate, die im Vergleich zu Patientinnen ohne TNFi-Therapie keinesfalls erhöht ist.
Und zum Schluss …
Impfdefizite bei deutschen Rheumapatienten wurden leider erneut in einer Untersuchung aus dem Rheumazentrum Rhein-Ruhr belegt, die allerdings aus versicherungsbasierten Daten im Jahr 2019 stammt – es bleibt unklar, ob ein späteres Untersuchungsdatum positivere Zahlen ergeben hätte. (30) Damals waren nur 37 % der durchwegs mit erhöhten Risiken behafteten Patienten gegen Influenza geimpft, gar nur 6 % gegen Pneumokokken. Kam mit einem Alter ≥60 Jahre ein weiteres Risiko hinzu, so lag die Rate mit 47 % bzw. 8,2 % nur unwesentlich höher. Nach wie vor gilt, dass die Impfraten in den neuen Bundesländern deutlich über denen der alten liegen. Mittlerweile ist bestens bekannt, dass Patienten unter JAKi-Therapie gegen Herpes Zoster geimpft sein sollten. Eine spanische Untersuchung mit rund 150 Patienten zeigte nun, dass diese Impfung besser vor Beginn des JAKi-Einsatzes erfolgen sollte. (31) Erfolgte die Impfung erst bei bereits laufender Therapie, so waren die erreichten Impftiter de facto halbiert. Es ist allerdings unklar, inwieweit durch die niedrigeren Titer auch das Herpes Zoster-Risiko tatsächlich erhöht ist.
Mediterrane Diät ist gesund – das ist unbestritten. Bisher konnte man aber lesen, dass dadurch nicht auch zusätzlich die Krankheitsaktivität der RA gesenkt wird. Jetzt hat aber erstmals eine kontrollierte griechische Studie mit 210 Patienten diese Wirkung postuliert. (32) Verglichen wurden darin eine klassische mediterrane Diät und normale Ernährung unter gleichlaufender DMARD-Therapie in beiden Gruppen. Unter der Diät kam es über drei Monate nicht nur zu einer signifikanten Abnahme von Gewicht, BMI und Körperfetten, sondern auch zu einer signifikanten Verbesserung des DAS28 (1,56 vs. 2,12).
Prof. Dr. med. Klaus Krüger
Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie
Praxiszentrum St. Bonifatius
St.-Bonifatius-Str. 5, 81541 München
Literatur: 1 Mohta TV et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 1433 (POS1416) | 2 Otero-Valera L et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 785 (POS0585) | 3 Frechette N et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 62 (OP0070) | 4 Kerschbaumer A et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 1156 (Poster POS1058) | 5 Dusser P et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 500 (POS0226) | 6 Tidblad L et al., RMD Open 2025; 11(2): e005430 | 7 Kuettel D et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 803 (POS0608) | 8 Richter A et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 811 (POS0616) | 9 Whittle S et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 728 (POS0514) | 10 Palmowski A et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 1028 (POS0896) | 11 Deniz R et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 832 (POS0646) | 12 Buttgereit F et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 51 (OP0058) | 13 Wiebe E et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 1305 (POS1252) | 14 Kharouf F et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 406 (POS0111) | 15 Barner Dalgaard E et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 447 (POS0160) | 16 Ørbo HS et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 153 (OP0183) | 17 Schäfer M et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 722 (POS0506) | 18 Aymon R et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 193 (OP0232) | 19 Molina-Collada J et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 57 (OP0065) | 20 Huss V et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 60 (OP0067) | 21 Burmester GR et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 1185 (POS1097) | 22 Compán O et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 726 (POS0511) | 23 Yamada K et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 445 (POS0157) | 24 Beltagy A et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 61 (OP0069) | 25 Verschueren P et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 779 (POS0578) | 26 Bevers K et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 784 (POS0584) | 27 De Cock D et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 914 (POS0751) | 28 Al Nokhatha S et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 1033 (POS0902) | 29 Carmona A et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 1631 (ABS0418) | 30 Kiltz U et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 392 (POS0097) | 31 Sieriro Santos C et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 1173 (POS1078) | 32 Virvili A et al., Ann Rheum Dis 2025; 84 (Suppl1): 752 (POS0546)